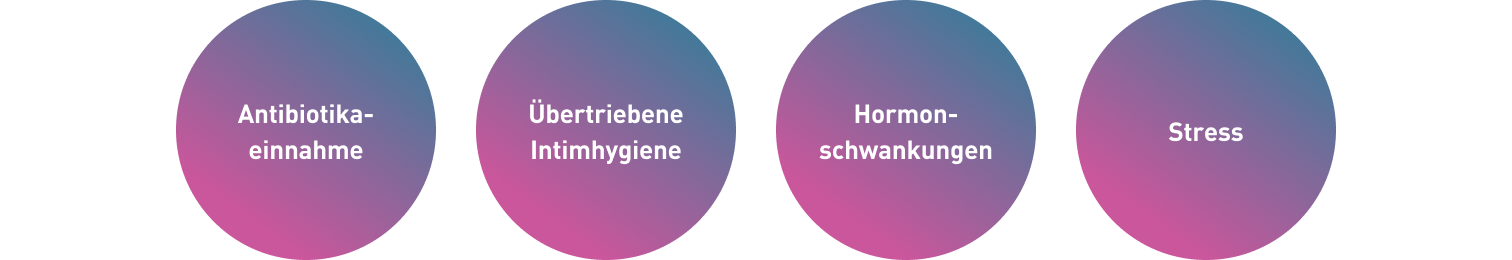Mikroflora im Gleichgewicht: Die Bedeutung von Milchsäurebakterien
Laktobazillen sind Milchsäurebakterien, die wichtig für den Aufbau und die Aufrechterhaltung des Mikrobioms in Darm, Urogenitaltrakt und Scheide sind. Sie erzeugen ein saures Milieu, das schädliche Keime hemmt und Blasenentzündungen vorbeugen kann. Ein Mangel kann Infektionen begünstigen. Alles Wichtige hier!
Was sind Laktobazillen?
Was sind Laktobazillen?
Laktobazillen (Gattung Lactobacillus) sind eine Gruppe von Bakterien, die zur Familie der Milchsäurebakterien gehören. Hier sind einige ihrer Hauptmerkmale und Funktionen:
Laktobazillen befinden sich natürlicherweise im menschlichen Magen-Darm-Trakt, in der Mundhöhle, in der Scheide und im Urogenitalbereich. Sie sind wichtige Bestandteile dieser Körperregionen und tragen zum Aufbau einer gesunden Mikroflora (Mikrobiom) bei.
Die Bakterien haben sich im Laufe der Evolution besonders gut an die menschlichen Wirtsverhältnisse angepasst und können so die Magen-Darm-Passage sehr gut lebend überstehen. Grund dafür ist, dass sie selbst Milchsäure produzieren, weshalb ihnen eine saure Umgebung im Vergleich zu anderen, nicht säurebildenden Bakterien nur wenig anhaben kann.
Durch die Produktion von Milchsäure senken Laktobazillen den pH-Wert ihrer Umgebung, was das Wachstum schädlicher Mikroorganismen hemmen kann.
Laktobazillen sind häufig in probiotischen Präparaten enthalten. Diese Probiotika bestehen aus lebenden Mikroorganismen, die bei ausreichender Einnahme gesundheitliche Vorteile bieten können.
Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) können Probiotika eine akzeptable Alternative zu Antibiotika darstellen.1
Vaginales Mikrobiom
Welche Rolle spielen Milchsäurebakterien für das Mikrobiom im Intimbereich?
Das vaginale Mikrobiom besteht hauptsächlich aus Laktobazillen, die eine schützende Rolle spielen. Diese Bakterien produzieren Milchsäure, die den pH-Wert der Vagina niedrig hält und eine saure Umgebung schafft, die das Wachstum schädlicher Mikroorganismen hemmt.
Faktoren wie Antibiotika, hormonelle Veränderungen und übertriebene Intimhygiene stören das Gleichgewicht des vaginalen und urogenitalen Mikrobioms, was zu Infektionen (Pilzinfektionen, bakterielle Vaginose) und anderen gesundheitlichen Problemen führen kann.
Laktobazillen besiedeln nach oraler Einnahme den Darm und gelangen von dort unverändert in den Urogenitalbereich, einschließlich der Vagina und des Harnröhreneingangs. Sie sind sehr resistent gegen Magensäure und überstehen so die Magenpassage.
Im Intimbereich tragen sie zur Wiederherstellung des urogenitalen Mikrobioms bei, indem sie Milchsäure produzieren, die den pH-Wert senkt und so das Wachstum schädlicher Erreger hemmt. Laktobazillen gedeihen am besten auf feuchten Oberflächen wie im Magen-Darm-Kanal und der äußeren Haut (insbesondere in Hautfalten des Gesäß- und Genitalbereichs).
Laktobazillen bei Blasenentzündung
Können Milchsäurebakterien bei einer Blasenentzündung helfen?
Zu wenig Milchsäurebakterien erleichtern unter Umständen die Entstehung einer Blasenentzündung mit ihren unangenehmen Symptomen, da diese Bakterien eine schützende Rolle für die Darm- und Vaginalflora spielen.
Aus dem Grund können Laktobazillenfür die Vorbeugung und bei der Behandlung einer Blasenentzündung wichtig sein: Denn Milchsäurebakterien sind die Art von „guten“ Bakterien, die wir im Darm, in der Scheide und im Urogenitalbereich haben wollen:
Laktobazillen, wie Lactobacillus rhamnosus und Lactobacillus reuteri, können dazu beitragen, die natürliche Mikroflora im Urogenitalbereich zum Beispiel nach einer Antibiotikatherapie wiederherzustellen.
Eine Antibiotikabehandlung tötet im Körper häufig auch nützliche Bakterien, was das vaginale Gleichgewicht stört und schädliche Bakterien wachsen lässt. Eine gesundes, urogenitales Mikrobiom ist deshalb entscheidend, um das Wachstum von krankheitserregenden Bakterien zu verringern.2,3
Die Milchsäurebakterien stellen Milchsäure her, die die Umgebung in der Blase und im Urogenitalbereich saurer macht. Eine saure Umgebung erschwert es schädlichen Bakterien wie beispielsweise E. coli (häufigster Auslöser urogenitaler Infektionen) sich dort anzusiedeln und zu wachsen.4
Laktobazillen produzieren Substanzen, die eine Schutzschicht auf der Vaginalschleimhaut bilden. Diese Barriere verhindert, dass sich schädliche Bakterien anheften und Infektionen verursachen.2
Klinische Studien haben gezeigt, dass die Therapie von Harnwegsinfekten mit Probiotika sicher und wirksam ist.5
Einnahmemöglichkeiten
Wie nehme ich Laktobazillen ein?
Präparate mit Laktobazillen kannst du oral oder vaginal zur Stärkung und Wiederherstellung der geschädigten urogenitalen Mikroflora (Mikrobiom) einsetzen:
Probiotische Präparate enthalten hohe Konzentrationen an Laktobazillen und sind als Kapseln, Tabletten oder Pulver erhältlich. Folge den Anweisungen auf der Packung oder denen deiner Ärztin/deines Arztes oder deiner Apotheke.
Typischerweise nimmst du diese täglich ein, oft zusammen mit einer Mahlzeit, um die Überlebensrate der Bakterien zu erhöhen. Laktobazillen siedeln sich nach oraler Aufnahme im Urogenitalbereich an und können das Auftreten wiederkehrender Harnwegsinfektionen durch spezifische, physikalische Eigenschaften verringern.6
Für diese gibt es speziell formulierte Vaginalzäpfchen oder -kapseln mit Milchsäurebakterien, die du direkt in die Scheide einführst. Befolge die Anweisungen auf der Packung oder die deiner Ärztin/deines Arztes oder deiner Apotheke. Normalerweise werden sie abends vor dem Schlafengehen eingeführt.
Mangel an Milchsäurebakterien
Mangel an Milchsäurebakterien: Mögliche Symptome
Laktobazillen sind nützliche Bakterien, die in verschiedenen Teilen des menschlichen Körpers vorkommen. Ein Mangel der schützenden Bakterien kann dazu führen, dass der antibakterielle Schutz verloren geht und die Scheidenflora gestört ist.7 Das machen sich einige Krankheitserreger zunutze und lösen unter anderem diese unangenehmen Symptome aus:
Juckreiz
Rötungen
ständiger Harndrang, häufig mit Schmerzen/Brennen beim Wasserlassen
Ausfluss (unter Umständen übelriechend, weißlich oder krümelig)
Schmerzen im Unterleib
Verschiedene Faktoren können für eine gestörte Scheidenflora verantwortlich sein:
FAQs
FAQs: Fragen und Antworten zu Milchsäurebakterien (Laktobazillen)
Laktobazillen gehören zur Gattung Lactobacillus und sind eine Bakteriengruppe, die zur Familie der Milchsäurebakterien zählen. Die Bakterien kommen in der menschlichen und tierischen Mikroflora vor und produzieren Milchsäure.
Milchsäurebakterien sind gut für die Aufrechterhaltung einer gesunden Mikroflora im Magen-Darm-Trakt und Urogenitalbereich. Laktobazillen können den pH-Wert senken und ein ungünstiges Milieu für schädliche Bakterien schaffen. Dadurch lässt sich unter Umständen Infektionen wie bakterieller Vaginose und Harnwegsinfektionen vorbeugen.
Bei zu wenig Milchsäurebakterien kann das Gleichgewicht der Mikroflora im Magen-Darm-Trakt und des Urogenitalbereichs gestört werden, was das Risiko für Infektionen wie Blasenentzündungen, bakterielle Vaginose und Harnwegsinfektionen erhöht. Außerdem können Verdauungsprobleme mit Symptomen wie Blähungen, Durchfall oder Verstopfung auftreten.
Bakterien in der Blase werden hauptsächlich durch Antibiotika abgetötet, die gezielt gegen die Erreger wirken. Allerdings töten Antibiotika auch nützliche Bakterien, was das Gleichgewicht der Mikroflora stören kann und somit das Risiko für erneute Infektionen womöglich erhöht.
Nimm Milchsäurebakterien ein, um das urogenitale Mikrobiom nach einer Antibiotikabehandlung wiederherzustellen oder Harnwegsinfektionen vorzubeugen. Die Laktobazillen-Stämme Lactobacillus rhamnosus und Lactobacillus reuteri sind wissenschaftlich sehr gut untersucht.
Lebensmittel, die Milchsäurebakterien enthalten, sind beispielsweise Joghurt, Sauerkraut und andere fermentierte Gemüsesorten.8
Mehr Informationen zum Thema
Quellen
- 1 „Probiotics in food Health and nutritional properties and guidelines for evaluation“. Fao.org, https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/382476b3-4d54-4175-803f-2f26f3526256/content. Zugegriffen 2. Mai 2025.
- 2 „Praxiserhebung bestätigt Studienergebnisse“. Pharmazeutische Zeitung online, https://www.pharmazeutische-zeitung.de/index.php?id=36090. Zugegriffen 2. Mai 2025.
- 3 Mendling, Werner. „Back to the roots – mit Laktobazillen und Probiotika“. Frauenarzt, Bd. 2009, Nr. 50, S. 396–404.
- 4 Bär W., Suerbaum S. (2016) Physiologische Bakterienflora: Regulation und Wirkungen, iatrogene Störungen und Probiotika. In: Suerbaum S., Burchard GD., Kaufmann S., Schulz T. (eds) Medizinische Mikrobiologie und Infektiologie. Springer-Lehrbuch. Springer, Berlin, Heidelberg.
- 5 Reid, Gregor, u. a. „ProbioticLactobacillusdose Required to Restore and Maintain a Normal Vaginal Flora“. FEMS Immunology and Medical Microbiology, Bd. 32, Nr. 1, 2001, S. 37–41, https://doi.org/10.1111/j.1574-695x.2001.tb00531.x.
- 6 De Alberti, Davide, u. a. „Lactobacilli Vaginal Colonisation after Oral Consumption of Respecta Complex: A Randomised Controlled Pilot Study“. Archives of Gynecology and Obstetrics, Bd. 292, Nr. 4, 2015, S. 861–867, https://doi.org/10.1007/s00404-015-3711-4.
- 7 Grübler, Beate. „Bei bakterieller Vaginose fehlen Milchsäurebakterien“. Springer Medizin Verlag GmbH, Ärzte Zeitung, 1. Dezember 2009, https://www.aerztezeitung.de/Medizin/Bei-bakterieller-Vaginose-fehlen-Milchsaeurebakterien-374772.html.
- 8 „Warum Milchsäurebakterien so gesund sind“. Internisten-im-netz.de, https://www.internisten-im-netz.de/aktuelle-meldungen/aktuell/warum-milchsaeurebakterien-so-gesund-sind.html. Zugegriffen 2. Mai 2025.